Ob heiße Tage, trockene Monate ohne Regen oder zu viel auf einmal bei Starkregen – die Auswirkungen der Klimakrise sind bereits vor der eigenen Tür zu spüren. Naturbasierte Lösungen, also Maßnahmen, die von der Natur inspiriert oder unterstützt werden, helfen Klimawandelfolgen zu begegnen.
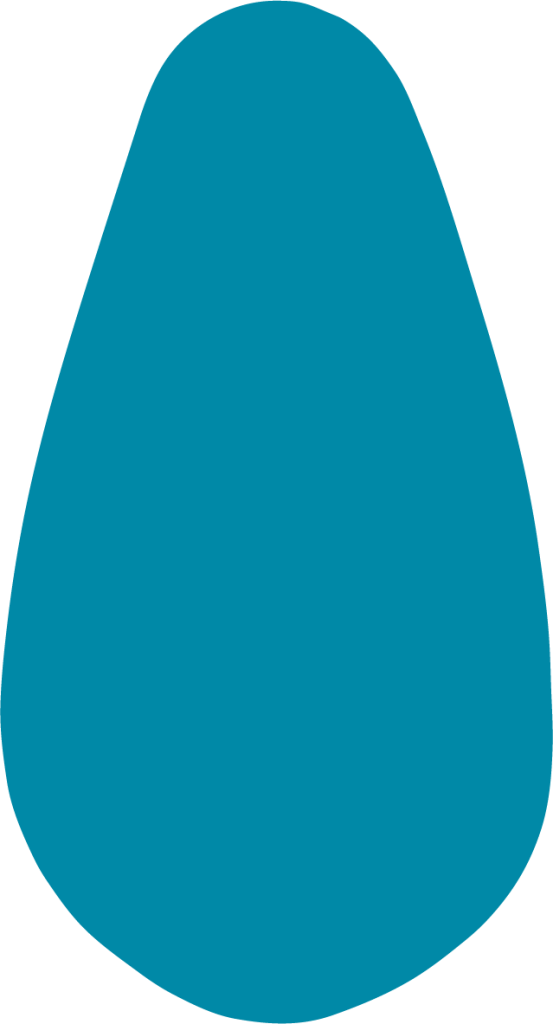

Was ist Klimaanpassung?
Die Klima(folgen)anpassung setzt sich mit der Entwicklung von Strategien und Maßnahmen auseinander, die zu einer Reduzierung der Empfindlichkeit natürlicher und menschlicher Systeme gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels führen wie z.B. Dürren, Hitze und Starkregen. Typische Beispiele solcher Maßnahmen sind der Bau von Hochwasserschutzanlagen, die Verwendung trockenresistenter Pflanzen in der Landwirtschaft oder die Entwicklung von Hitzeaktionsplänen. Klimaanpassung ist nicht mit Klimaschutz zu verwechseln. Letzterer umfasst Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemission durch die Vermeidung neuer Treibhausgasemissionen, z.B. durch erneuerbare Energien oder die Verkehrswende, oder durch die Bindung von Treibhausgasen in natürlichen Senken, wie Wäldern oder Mooren.
Beispiele zu konkreten Klimaanpassungsmaßnahmen und -projekten in der Praxis lassen sich in der Tatenbank des Umweltbundesamtes finden.
Was sind naturbasierte Lösungen?
Naturbasierte Lösungen sind gestalterische Maßnahmen, die von der Natur inspiriert sind und der Bewältigung ökologischer und sozialer Herausforderungen wie dem Biodiversitätsverlust, Temperaturanstieg, der Luftverschmutzung, Ernährungssicherheit, menschlichen Gesundheit oder dem Katastrophenschutz dienen. In Städten werden beim Einsatz naturbasierter Lösungen die von Pflanzen, Wasser, Böden und anderen natürlichen Elementen bereitgestellten Ökosystemleistungen genutzt, um die Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit, also die Resilienz von Städten zu erhöhen.
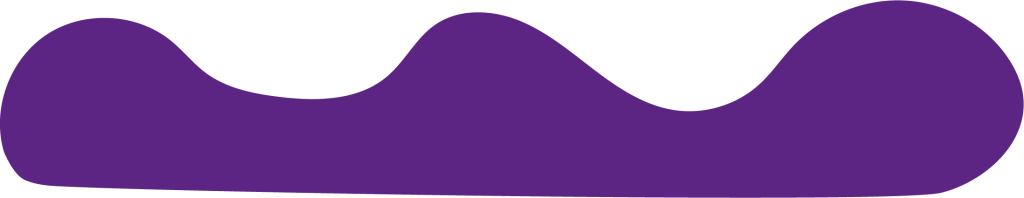


Was sind Beispiele von naturbasierten Lösungen zur Klimaanpassung von Städten?
Es gibt verschiedene naturbasierte Lösungen zur Förderung der Klimaanpassung von Städten. Zum Beispiel verbessert die Entsiegelung und Begrünung von Böden nach Starkregenereignissen die Versickerung des Regenwassers und verringert somit das Hochwasserrisiko. Dasselbe gilt für bepflanzte Versickerungsmulden und Rigolen. Grün- und Wasserflächen wie Parkanlagen, urbane Wälder, Flüsse, Auen oder Seen speichern Regenwasser, kühlen durch Verdunstung die Umgebung und sorgen selbst in heißen Sommern für kühle Orte zum Verweilen. Insbesondere schattenspendende Bäume verstärken diesen Kühleffekt und tragen gleichzeitig zur Verbesserung der Luftqualität bei.
In Stadtteilen, in denen eine Wiederherstellung, Aufwertung oder Neuschaffung von Grünflächen nicht möglich ist, können beispielsweise Dach- und Fassadenbegrünungen eingesetzt werden. Sie können die ökologischen Funktionen von Grün- und Freiflächen auf versiegelten und bebauten Flächen bis zu einem gewissen Grad ersetzen, indem sie Wasser zwischenspeichern, die Verdunstung erhöhen und die Gebäudeoberfläche beschatten. Darüber hinaus werden Niederschlagsspitzen reduziert und damit Entwässerungssysteme und Kanalisationen entlastet. Zudem kühlen sie im Sommer Gebäude und verhindern Wärmeverluste im Winter, wodurch Energie für Klimaanlagen bzw. Heizungen eingespart wird. Zuletzt schützen sie die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen und filtern Schadstoffe aus der Luft.
In den kommenden Monaten folgen hier praktische Hinweise zur eigenständigen Planung und Umsetzung naturbasierter Lösungen
